Moor-Faserverbundmatten für die Automobilindustrie
Der Donaumoos-Zweckverband hat sich zum Ziel gesetzt, unterschiedliche Wertschöpfungsmöglichkeiten für Moorkulturen zu erschließen, ihre technische Machbarkeit zu überprüfen und unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte Handlungsempfehlungen für die Landwirtschaft zu erarbeiten.
Neben aktuellen beziehungsweise bereits abgeschlossenen Versuchen zur Auffaserung von Moorkulturen, zur Papier- und Kartonagenproduktion, zur Herstellung faserverstärkter Kunststoffe und zur Entwicklung von Paludi-Bauplatten steht in diesem Kurzprojekt die Herstellung von Moorfaser-Verbundmatten und -Formteilen im Fokus.
Hierzu wurden im Rahmen des Förderprojektes „MoorBewi“ bereits erste grundlegende Testversuche zur Herstellung von Faserverbundmatten auf Basis von Streuwiesengras und Seggen beauftragt. Die erzielten Versuchsergebnisse belegten erfolgsversprechende Wertschöpfungsmöglichkeiten für die untersuchten Moorkulturen, so dass nun ein eigenes Kurzprojekt hierzu läuft.
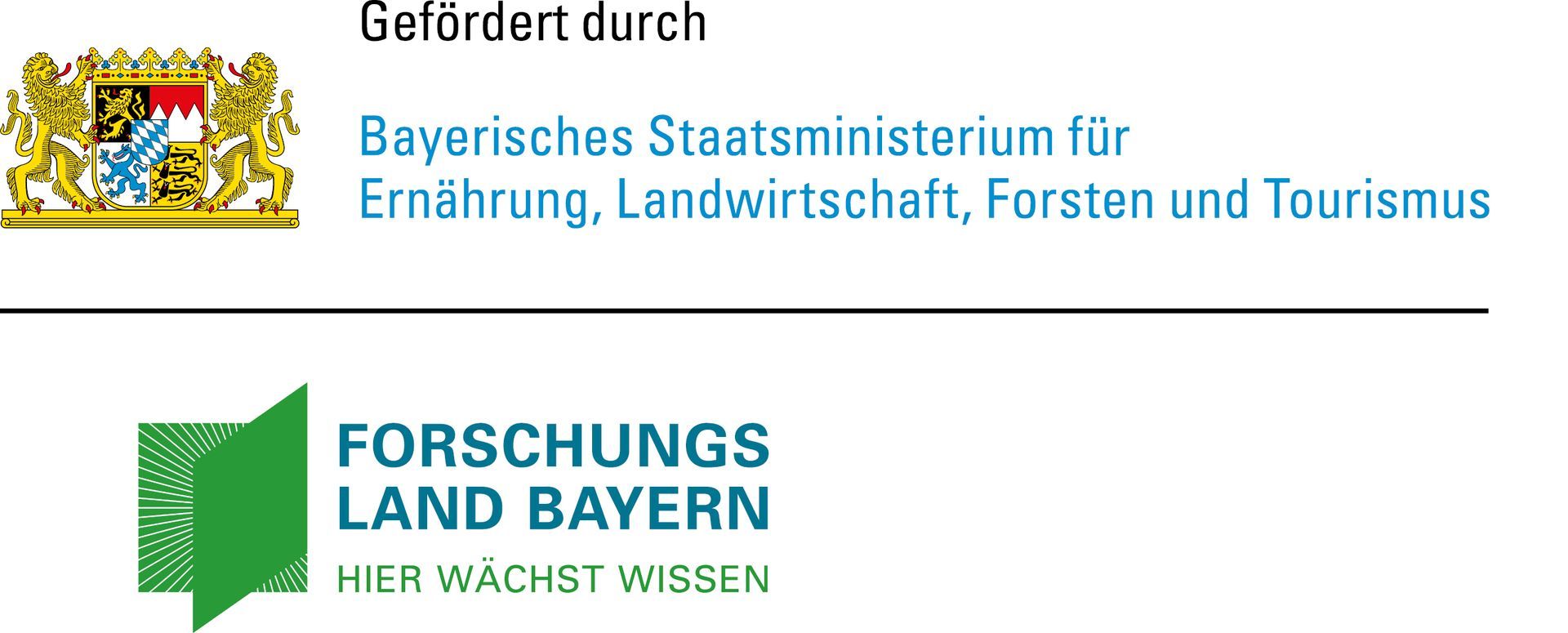

Das Projekt
Das Kurzprojekt mit dem Titel „MoorMotive – Moor-Faserverbundmatten für die Automobilindustrie“ wird zu 100 Prozent vom Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus gefördert und hat eine Projektlaufzeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2025.
Im Fokus des beantragten Forschungs- und Entwicklungsprojektes stehen Validierungsversuche, um das Potenzial von Moor-Faserverbundmatten für industrielle Großserienanwendungen, wie beispielsweise im Bereich der Automobilindustrie, abzuschätzen. In Voruntersuchungen ist bereits nachgewiesen worden, dass sich sowohl Streuwiesengras als auch Seggen hervorragend dazu eignen, Verbundmatten mit einem Gräseranteil von bis zu 80 Prozent herzustellen. Erste daraus erzeugte Formteile haben bereits optisch und haptisch wichtige Kriterien für eine Substitution bestehender Serien-Bauteile erfüllt. Diese positiven Ergebnisse sollen nun im Hinblick auf eine Serienfertigung im industriellen Maßstab validiert werden.

Vorgehen
Um die Möglichkeit einer späteren Produktzulassung zu prüfen, sollen anhand erster Referenzbauteile (z.B. Hutablagen) Analysen und Qualitätstests durchgeführt werden. Hierbei stehen die speziell für die Automobilindustrie erforderlichen Validierungsversuche, wie beispielsweise Geruchs- und Emissionstests, Klimawechseltests, Feuchte-, Kälte- und Wärmelagerung, im Vordergrund.
Gleichzeitig werden im Projekt technische Optimierungsmöglichkeiten hinsichtlich der Vorbehandlung der Moorkulturen, des Rohstoffeinsatzes und der Anlagentechnik untersucht. Dabei ist neben dem optimierten Einsatz von Moorkulturen auch die Reduzierung beziehungsweise Vermeidung erdölbasierter Rohstoffe von Bedeutung. So werden im Projekt beispielsweise auch naturfaserverstärkte Kunststoffkomponenten eingesetzt, die auf Basis von Moorkulturen erzeugt werden.
Über die technischen Forschungsinhalte hinaus spielen auch wirtschaftliche Aspekte für die Verwertung von Moorkulturen im Bereich der Moorfaser-Verbundmatten eine große Rolle. In diesem Zusammenhang wird zunächst eine Marktanalyse durchgeführt und anschließend ein Markteintrittskonzept erstellt. Dabei sind die CO2-Bewertungen eines möglichen Referenzbauteils und dessen Recycling-Fähigkeit beziehungsweise der sogenannte End-of-life-use von großer Relevanz und ebenfalls innerhalb des Kurzprojektes zu prüfen.
Hintergrund
Für die Flächeneigentümer und Bewirtschafter von Moorböden ist das Generieren von Einkommensmöglichkeiten das ausschlaggebende Argument dafür, ihre Flächen für den Moor- und Klimaschutz zur Verfügung zu stellen. Neben Förderprogrammen, wie zum Beispiel dem Moorbauernprogramm, können langfristig nur Bewirtschaftungserlöse als eine verlässliche Einkommensquelle angesehen werden. Mit dem Anbau von nässeverträglichen Paludikulturen können Moorbewirtschafter regionale Rohstoffquellen anbieten, die kurze Transportwege ermöglichen und damit verbunden CO2-Einsparungseffekte generieren.
Die verarbeitende Industrie sucht in der aktuell geopolitisch instabilen Situation nach verlässlichen Rohstoffquellen. Doch auch durch den Paradigmenwechsel von der konventionellen erdölbasierten Industrie hin zur nachhaltigen Bioökonomie stellt sich die Frage nach der Bereitstellung der enormen Mengen an benötigten Rohstoffen für industrielle Produktionsprozesse. Abseits von Recycling stellen nur nachwachsende Rohstoffe aus der Landwirtschaft eine strategische Lösung dieser Ressourcenproblematik dar.
Vor allem in der Region 10 mit der Großstadt Ingolstadt sowie den Landkreisen Eichstätt, Neuburg-Schrobenhausen und Pfaffenhofen an der Ilm, in welcher sich zahlreiche Automobilzulieferer und Technologieentwickler angesiedelt haben, ergeben sich realistische Chancen, nachhaltige Produkte für den Automobilbereich zu entwickeln und zu vermarkten. Ein Unternehmen, das sich in diesem Marktsegment mit innovativen Technologieentwicklungen beschäftigt, ist die Firma Koller Kunststofftechnik GmbH in Dietfurt an der Altmühl (Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz). Von der Bauteilentwicklung bis zur Industrialisierung und Serienproduktion deckt das Unternehmen ein breites Leistungsspektrum ab und hat – unterstützt durch einen eigenen Werkzeug- und Maschinenbau – die Möglichkeit, eigene Forschungsarbeiten durchzuführen. Dies sind ideale Ausgangsbedingungen für die geplanten Versuchsreihen mit Moorkulturen. Unter Zuhilfenahme bereits bestehender Referenzwerkzeuge wird so eine ressourceneffiziente Praxisforschung ermöglicht.
Die Initiative für das Projekt ging direkt vom Unternehmen selbst aus. Durch einen TV-Beitrag über die Wertschöpfungsprojekte des Donaumoos-Zweckverbands wurde die Firma auf die unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten von Moorkulturen aufmerksam. Sie zeigte von Anfang an großes Engagement und Eigeninitiative, innerhalb ihres Produktportfolios Verwendungsmöglichkeiten für Moorkulturen zu suchen und Forschungsideen zu entwickeln.


Foto: Utescheny/Koller Kunststofftechnik
