
Bauplatten aus moorverträglichen Kulturen
Moor- und Klimaschutz
Das Projekt „Anfertigung erster Paludibauplatten zur Bemusterung und Machbarkeitsbeurteilung" hat Wertschöpfungsmöglichkeiten für nässeverträgliche Moorkulturen im Bereich der Baubranche untersucht. Hierzu wurden erste Paludibauplatten durch händisch bediente Hydraulikpressen angefertigt, die anschließend auf ihre Produktqualität beziehungsweise hinsichtlich grundlegender bautechnisch relevanter Parameter untersucht wurden.
Projektträger war der Donaumoos-Zweckverband, der das Forschungs- und Entwicklungsprojekt im Rahmen des Projekts „Entwicklung moorverträglicher Bewirtschaftungsmaßnahmen für landwirtschaftlichen Moor- und Klimaschutz" umgesetzt hat.
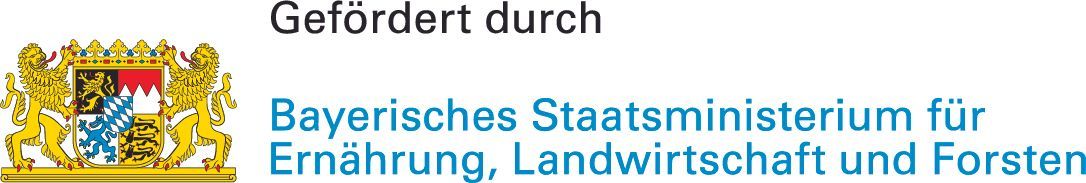

Die Ziele
Der Schlüssel für nachhaltige Ergebnisse des Gesamtprojektes „Klimaschutz durch Moorbodenschutz am Beispiel des Bayerischen Donaumooses" liegt in der Etablierung landwirtschaftlicher Wertschöpfungsketten. Nur durch die Entwicklung nachhaltiger Einkommensquellen kann auf lange Sicht der Schutz der Moore in Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft gelingen.
Besonderes Augenmerk gilt dabei auf den unterschiedlichen Verwertungsmöglichkeiten von Nasskulturen. Neben einem Auffaserungsprojekt für die Verwertung in der Papier-, Karton- und Verpackungsbranche untersucht der Donaumoos-Zweckverband auch die Nutzung von Moorkulturen im Bereich der Baubranche. Im Rahmen des Projekts sollte überprüft werden, ob eine Paludibauplatte das Endprodukt für den Aufbau einer solchen Wertschöpfungskette sein könnte.

Die Ergebnisse
Das von Mai 2023 bis Mai 2024 durchgeführte Kurzprojekt lieferte im Wesentlichen folgende Ergebnisse:
Es konnte nachgewiesen werden, dass die auf bayerischen Moorböden geernteten Kulturen Seggen, Rohrglanzgras und Nasswiesenheu/Altgras grundsätzlich für die Produktion von stranggepressten Trockenbauplatten geeignet sind. Lediglich Schilf wurde im Laufe des Projekts als weitere untersuchte Paludikultur bis auf Weiteres für diese Verwertungsschiene zurückgestellt. Das mit der Herstellung der Platten beauftragte Unternehmen istraw GmbH & Co. KG konnte zunächst aus dem Rohmaterial händisch mit Hilfe von Hydraulik gepresste, beidseitig mit Karton beplankte Musterplatten in einer Dicke von 20 mm herstellen. Diese Platten wurden im Prüflabor der VHT in Darmstadt auf bautechnisch relevante Parameter wie Zug- und Biegefestigkeit untersucht. Die Prüfergebnisse zeigten deutlich, dass die Platten die erforderlichen Schwellenwerte aus der DIN EN 14577:2005 „Strangpressplatten Anforderungen“ um ein Vielfaches übertrafen. Es ist daher davon auszugehen, dass im Strangpressverfahren kontinuierlich hergestellte Platten die Richtwerte für eine Bauzulassung erreichen würden. Dies wäre mit weiteren Prüfungen zu bestätigen.
Es war allerdings nicht möglich die geplante Produktionsanlage in Großbritannien soweit fertigzustellen, dass erstmals maschinell und kontinuierlich stranggepresste Paludibauplatten hätten produziert werden können. Grund dafür war vor allem ein dem Projekt gesetzter maximaler Zeitraum von einem Jahr, personell limitierte Kapazitäten beim Maschinenbauer sowie finanzielle Grenzen. Materialbeschaffung und Montageschwierigkeiten sorgten für erhebliche unvorhersehbare zeitliche Verzögerungen. Der Maschinenbauer konnte daher die Pilotanlage nicht mehr rechtzeitig fertigstellen. Das Projekt musste daher – ohne sein eigentliches Ziel erreicht zu haben – unvollendet abgeschlossen werden.
Die gewonnenen Erkenntnisse können trotzdem als Basis und Meilenstein für den Aufbau dieser Verwertungsschiene gesehen werden, wenn es gelingt die Maschine zeitnah in Betrieb zu nehmen und eine erste Produktionslinie für Moorkulturen in Deutschland aufzubauen. Hintergrundinformationen zur Baubranche, der Technologie sowie deren Geschäftsmodell zeigen, dass eine erfolgreiche Umsetzung einen erheblichen Beitrag zum Klima- und Moorschutz liefern könnte. Haupttreiber dafür sind allerdings weniger Moorschützer im eigentlichen Sinne, sondern vielmehr die Baubranche selbst die unter enormem Druck steht, bald klimaneutrale Gebäude zu errichten. Baustoffe aus nachwachsenden Rohstoffen sind daher zur Zielerreichung für die Baubranche eine sehr vielversprechende Alternative. Die Arbeiten fanden zwischen 15. Mai 2023 und 15. Mai 2024 statt.
Der Hintergrund
Mit einer Ausdehnung von zirka 180 Quadratkilometern birgt das Altbayerische Donaumoos als größtes Moor Süddeutschlands enorme Klimaschutzpotenziale. Freiwilliger Klimaschutz, der sowohl die Bürger als auch die Landwirtschaft mit einbindet, kann jedoch nur gelingen, wenn alternative Einkommensmöglichkeiten damit verbunden sind. Darüber sind sich Wissenschaft, Politik und Gesellschaft mittlerweile im Klaren.
Paludi-Bauplatten – als Alternative zu herkömmlichen Gipskartonplatten – haben dabei große Chancen, sich in der Baubranche zu etablieren. Grund dafür ist ihre mehrfach klimapositive Wirkung, die es ermöglicht, CO2-Emissionen anderer Baustoffe wie Beton und Glas zu kompensieren. So lassen sich durch den Verbau von Paludi-Bauplatten nicht nur beträchtliche Mengen an Kohlenstoffdioxid im Produkt binden, sondern auch durch die Kombination mit Moorschutzmaßnahmen weitere CO2-Mengen im Boden speichern.
Obwohl die klimapositiven Eigenschaften auf der Hand liegen und erste Tests im Kleinstmaßstab sehr vielversprechend waren, galt es zunächst eine Machbarkeitsabschätzung hinsichtlich der Marktpotenziale von Paludi-Bauplatten durchzuführen. Nur wenn die hohen Anforderungen der Baubranche erfüllt werden und eine Zulassung erwirkt werden kann, kann die Paludibauplatte im Rahmen der Bauwende dazu beitragen, Gebäude nachhaltiger zu errichten.

Das Kurzprojekt sollte also die Lücke schließen zwischen den ersten grundlegenden Versuchen zur Herstellung von Paludi-Bauplatten, die zum damaligen Zeitpunkt mithilfe von Standardeinstellungen einer herkömmlichen Stroh-Pressanlage durchgeführt wurden, und einer neuen anpassungsfähigeren Technologie, die hinsichtlich ihrer Eignung für Paludi-Kulturen ein größeres Potenzial verspricht.
Am Ende dieses Kurzprojekts sollten alle grundlegenden Voruntersuchungen abgeschlossen sein, die eine realistische Markteinschätzung des Produkts „Paludi-Bauplatte“ zulassen und Handlungsempfehlungen für die Landwirtschaft ermöglichen würden. Damit wollte der Donaumoos-Zweckverband das Risiko für kleine, regionale Verarbeitungsbetriebe reduzieren und einen ersten Schritt hin zu einer Markteinführung des Produkts leisten.
Eine spätere, zwingend erforderliche, Produktzulassung und -zertifizierung, die entscheidend für die Vermarktung von Paludi-Bauplatten ist, wollte und will der Donaumoos-Zweckverband einem möglichen verarbeitenden Betrieb überlassen.

